Fasching, Spaß und Ausgelassenheit hatten immer schon einen Stellenwert in der katholischen Kirche. Dabei gibt es auch sprachlich eine deutliche Verbindung zwischen Kirche uns närrischem Treiben, wenn man den Begriff „Fastnacht“ hernimmt. Damit ist die Nacht oder Vorabend vor dem 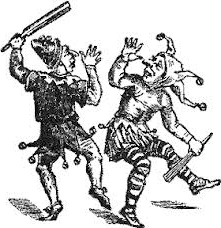 Aschermittwoch, dem Beginn der katholischen Fastenzeit gemeint. Heute hat sich der Begriff Fasching für eine besondere Zeit im Jahr festgesetzt, die von närrischen Festen, Bällen und Tanzveranstaltungen dominiert ist. Die Wurzeln von „Fasching“ liegen in der mittelalterlichen deutschen Sprache. Das Wort leitet sich von „Fastenschank“ her, also dem letzten Ausschank (alkoholischer Getränke) vor der strengen Fastenzeit. Im Gegensatz dazu betont der Begriff „Karneval“ den anstehenden Fleischverzicht in der Fastenzeit: „Carne, vale“ bedeutet übersetzt so viel wie „Fleisch, lebe wohl“.
Aschermittwoch, dem Beginn der katholischen Fastenzeit gemeint. Heute hat sich der Begriff Fasching für eine besondere Zeit im Jahr festgesetzt, die von närrischen Festen, Bällen und Tanzveranstaltungen dominiert ist. Die Wurzeln von „Fasching“ liegen in der mittelalterlichen deutschen Sprache. Das Wort leitet sich von „Fastenschank“ her, also dem letzten Ausschank (alkoholischer Getränke) vor der strengen Fastenzeit. Im Gegensatz dazu betont der Begriff „Karneval“ den anstehenden Fleischverzicht in der Fastenzeit: „Carne, vale“ bedeutet übersetzt so viel wie „Fleisch, lebe wohl“.
Das typische Verkleiden an den „tollen Tagen“ hat seinen Ursprung im Mittelalter, als Europa defakto katholisch war. Am 28. Dezember, dem Fest der heiligen unschuldigen Kinder, wurde mancherorts ein Kinderbischof „gekürt“. Darüber hinaus übernahmen niedere Kleriker vorübergehend Rang und Privilegien der höheren Geistlichkeit. Kirchliche Rituale wurden parodiert.
Die Kirche duldete – mit Rückgriff auf das augustinische Zwei-Staaten-Modell – solche Eskapaden. Der Karneval stand für die „civitas diaboli“, den Staat des Teufels. Gleichsam als didaktische Maßnahme blieb die Kirche während der Fastnacht untätig, um zu zeigen, dass die „civitas diaboli“ wie auch der Mensch vergänglich ist und Gott schließlich siegreich bleibt. Mit dem Aschermittwoch musste daher die Fastnacht enden, um die unausweichliche Umkehr zu Gott zu verdeutlichen.
In diesem Sinne, genießen Sie die „Tollen Stunden und Tage“, und wer weiß ob nicht auch Gott seine Freude an unserer Freude hat. Ihn sollten wir jedenfalls in all unser Tun immer einschließen.







